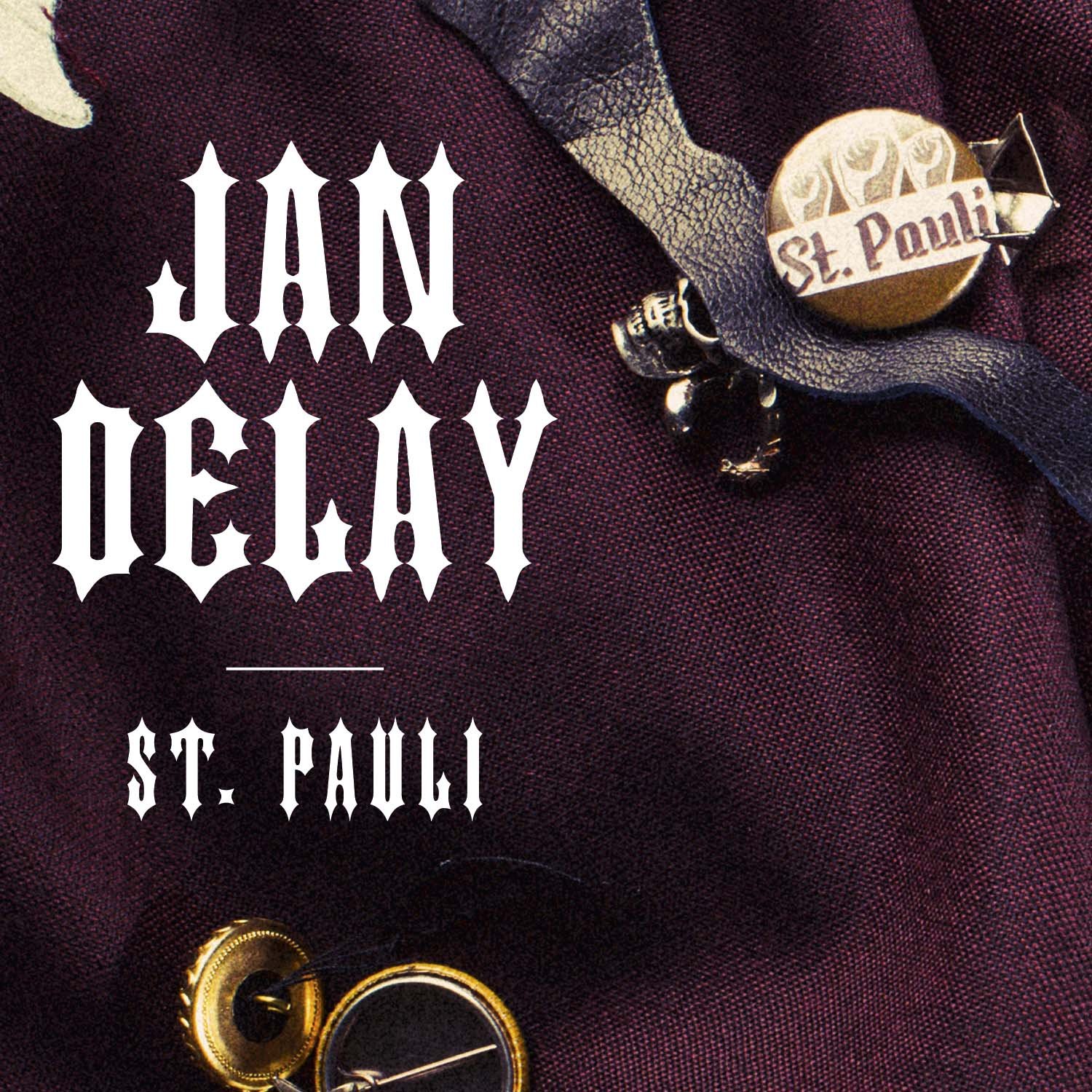Im Hintergrund der deutschen wikipedia tobt ein kleiner Krieg. Schön zu beobachten in der Löschdiskussion um Robin Schulz. Der hat kürzlich Waves von Mr. Probz zum Hit gemacht, ohne seinen Remix würde heute niemand Mr. Probz kennen. In der wikipedia geht es nun aber beständig darum, ob ein DJ relevant genug sei, um mit einem eigenen Artikel auftauchen zu dürfen. Beliebtes Argument: “Der hat doch nur einen Beat drunter gelegt. Das ist keine künstlerische Leistung.”
Hmm – nun mögen das andere beurteilen, wieviel Kunstverständnis oder Talent dazu gehört aus einem weinerlichen Rapsong ein unterhaltsames Stück Musiktapete zu machen. Ohne diese Kombination jedoch würden wir eine ganze Reihe von Titeln nicht kennen. Und auch für diese vielleicht minimale Ergänzung muss man erstmal ein Gefühl entwickeln, welcher Beat passt wie wo drunter? Ich behaupte auch Riptide von dem Australier Vance Joy ist so ein Titel, den wir nur kennen, weil sich da jemand genau diese Gedanken gemacht und das dann auch noch realisiert hat. Ohne den Flic Flac-Remix würde der Singer-Songwriter weiterhin sein Publikum auf dem fünften Kontinent verzaubern, in Europa jedoch ein Nobody sein.
Nun weiß natürlich kaum jemand, wer diese Flic Flac-DJs sind. Und das obwohl sie sowohl Milky Chance wie auch Bedouin Soundclash aufgemotzt haben und damit deren Erfolg ordentlich beförderten. Das mögen viele nicht gern hören – die beiden stehen ja in den seltensten Fällen vorn auf dem Cover. Was aber nichts an deren Wichtigkeit (oder in wikipedia-deutsch: Relevanz) ändert. Früher waren es halt Produzenten wie Frank Farian oder Giorgio Moroder, die an den Knöpfen drehten und erst solche Acts wie Boney M., Donna Summer oder Milli Vanilli zu Ruhm brachten (die in den allerschlimmsten Fällen nicht mal wirklich singen konnten). Heut sind’s halt die DJs.
Was haben nun Flic Flac mit Riptide gemacht. Sie haben das Akustikgitarren-Liedlein für Folk-Fans und Neo-Hippies verwandelt in einen gängigen DeepHouse-Lounge-Hit. Muss man nicht mögen. Muss man aber zugeben, dass die Leichtigkeit des Mixes den Titel sehr viel konsumierbarer und massentauglicher macht. Das soll nicht heißen, dass es nicht genügend Akustik-Liedermacher-Fans gibt – so lange ist die Stripped Down-Welle ja auch noch nicht vorüber – allerdings wage ich ernsthaft zu bezweifeln, dass Titel Nummer eins auf der EP (das Original ohne Remix) die gleiche Anzahl an Radioeinsätzen hat, wie es derzeit der Flic Flac-Mix hat (Track 6). (Offizielle Zahlen dazu gibt es leider nicht, so wie in den offiziellen Charts von media control ja auch alle Versionen und Mixe unter einem einzigen Eintrag zusammengefasst werden, was letztendlich nur die institutionelle Entsprechung zur wikipedia-Relevanzdiskussion ist.)
Was sagen nun schon Verkaufszahlen über die Qualität der umgesetzten Musik aus? Wahrscheinlich nicht immer viel, allerdings wenn man Relevanz und Erfolg in Zahlen messen will, dann landet man eben doch fast zwangsläufig bei solch befragbaren Dingen wie Umsätzen oder Airplays. Kann also jetzt jede und jeder selbst entscheiden, welche Variante die schönere oder kunstvollere ist.
Ansonsten muss ich zu Deep House und Folk hier nichts weiter sagen. Das ist bereits alles ausgewertet und da fügt auch Vance Joy außer einem gepfiffenen Refrain nicht wirklich etwas Neues hinzu. Und selbst der erinnert mich irgendwie an One Hit-Singer Charlie Winston und sein Like A Hobo. Ich schätze mal, der Sommer wird uns noch eine ganze Menge ähnlich fabrizierter Hits bringen. Flic Flac sind da vielleicht nicht mal die schlechteste Wahl. Warum haben die eigentlich noch keinen wikipedia-Eintrag?